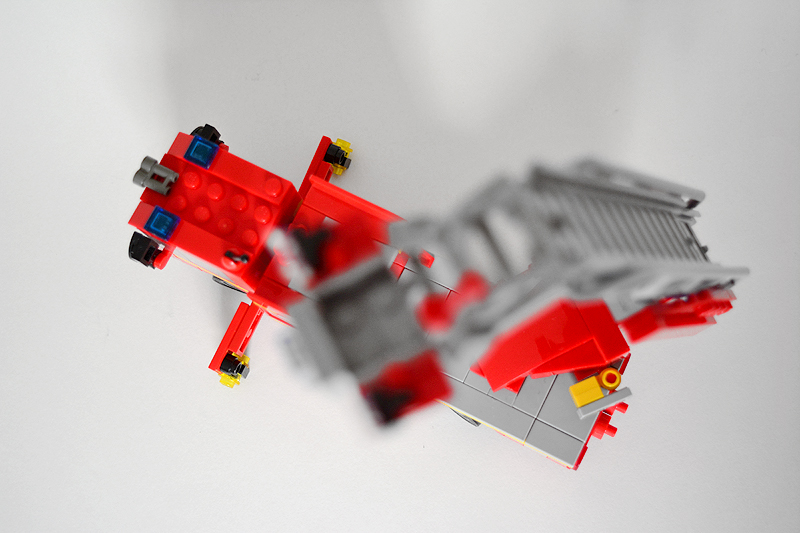Mit ihren unbemannten Ferndiagnossystemen steht die Feuerwehr Farnheim mit einer weiteren Fachgruppe seit Anfang des Jahres im Dienst der Gefahrenabwehr. Gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Einsatzrobotik (DEZERO) leistet mit der neuen „Robotik Task Force“ Forschungsarbeit, bspw. taktische Vorgehensweisen zu verschiedensten Einsatzszenarien mithilfe der Einsatzrobotik.
„Es sei zwar noch erhebliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit nötig, bis Feuerwehren das Potenzial von Robotern im Einsatzdienst vollends ausschöpfen können“, so der Leiter der RTF Sönke Richmann, aber durch die Feldforschungen in der Einsatzpraxis sei man auf einem guten Weg.
Die Einsatzrobotik der Feuerwehr kann in vielen Bereichen die Arbeit der Einsatzkräfte unterstützen:
- Das Erhöhen der Sicherheit der Einsatzkräfte, indem Roboter Arbeiten in einsturzgefährdeten Bereichen übernehmen
- Mit der Erkundung aus der Luft Lageeinschätzungen verbessern und beschleunigen. Rettungsmaßnahmen können so schneller greifen
- Autonome Personen- und Materialtransporte, Lösch- und Hilfeleistungsmaßnahmen können das Personal vor Ort entlasten
Da die technischen Voraussetzungen tw. geschaffen sind, ist die Fortentwicklung, insbesondere der Einsatztaktiken, eine der wichtigsten Forschungsfelder des DEZEROs.
Mit der Aufklärung und Erstellung eines entsprechenden Lagebildes an unwegsamen oder unübersichtlichen Einsatzstellen hat die neue „Robotik Task Force“, kurz RTF, ihre Arbeit aufgenommen. Als Einsatzfahrzeug dient ihr ein geräumiger Transporter mit Hochdach, langem Radstand und Allradantrieb. Er verfügt über ein Geräteabteil und einen witterungsunabhängigen Leitstand im Heck des Fahrzeugs. Die Beladung umfasst zwei Drohnen (eine Lasten- und eine Aufklärungsdrohne) sowie einen erdgebundenen Erkundungsroboter. Ferner sind auf dem Fahrzeug ein Generator, Werkzeuge und Ersatzteile verlastet, um mögliche Wartungs- oder Instantsetzungsarbeiten noch vor Ort an den Gerätschaften vornehmen zu können. Ausgestattet ist die an Bord befindliche Rettungsrobotik mit hochsensibler und -auflösender Sensorik, die vom Leitstand des Fahrzeugs fernsteuerbar ist.
Zu ihren wesentlichen Aufgabenbereichen zählen derzeit das Lokaliseren von verschütteten Personen, das Spüren und Messen von CBRN-Gefahrstoffen und ihrer Konzentration in Erde, Wasser und Luft sowie das Erstellen eines vollständigen, hochauflösenden und dreidimensionalen Lagebildes bei unübersichtlichen, umfangreichen oder/und schwer zugänglichen Einsatzstellen. Im Einsatz ist die RTF eng mit der Einsatzleitung und, falls nötig, mit der Fachgruppe Spüren & Messen verzahnt.
Die Robotik Task Force ist eine Teileinheit in der Katastrophenabwehr der Feuerwehr Farnheim.
Angefixt über einen Bericht des DRZ, dem Deutschen Rettungsrobotikzentrum, das zusammen mit dem Fraunhofer Institut und einer Forschungsgruppe für Rettungsrobotik der Feuerwehr Dortmund entstand und so in Deutschland bislang einmalig ist, wollte ich meiner Feuerwehr für ihre Drohne einen ähnlich Rahmen bieten. Da im Augenblick auch im modellbauerischen Teil meines Hobbies der Katastrophenschutz ein großes Thema einnimmt, fand ich die autonome Einsatzrobotik ein interessantes und äußerst spannendes Einsatzspektrum. So inspirierte mich auch der feuerwehreigene Gerätewagen der Feuerwehr Dortmund zu einem „Nachbau“. Verladen sind in ihm ein kleiner bodengebundener Roboter und eine größere Flugdrohne.